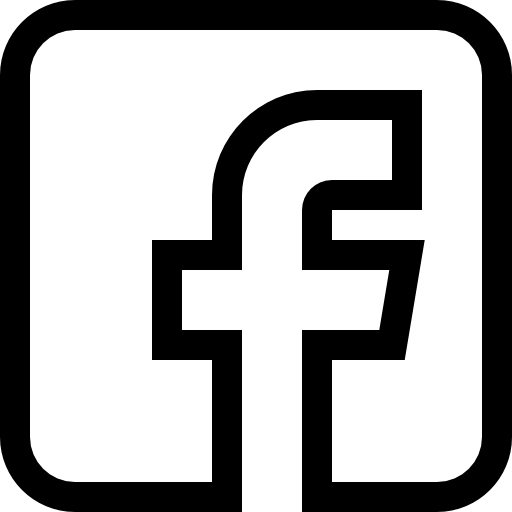Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kündigungsschutz bei Krankheit – das sagt das Schweizer Recht
- Verlängerung der Kündigungsfrist bei Krankheit nach Kündigung
- Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz während Krankheit
- Wie Sie sich auf eine rechtssichere Kündigung vorbereiten
- Der Kündigungsprozess: Sorgfalt und Respekt im Vordergrund
- Fazit: Kündigungen mit Augenmass und Verantwortung
- Häufige Fragen (FAQ)
Einleitung
In der Schweiz stellt die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses während einer krankheitsbedingten Abwesenheit eine besonders heikle Situation dar. Unternehmen stehen hier vor rechtlichen, ethischen und zwischenmenschlichen Herausforderungen. Wer in dieser sensiblen Phase die richtigen Schritte unternimmt, schützt nicht nur sich selbst vor juristischen Konsequenzen, sondern wahrt auch die Würde der betroffenen Person.
Dieser Beitrag vermittelt einen umfassenden Überblick über die geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften bei Kündigungen während einer Krankheit und zeigt auf, wie ein rechtssicheres und gleichzeitig menschlich verantwortungsvolles Vorgehen aussehen kann. Im Anschluss bieten wir eine strukturierte FAQ-Sektion mit den häufigsten Praxisfragen für Arbeitgebende.
Kündigungsschutz bei Krankheit – das sagt das Schweizer Recht
Grundsätzlich gilt im Schweizer Arbeitsrecht das Prinzip der Kündigungsfreiheit. Das bedeutet: Arbeitgebende können das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Fristen beenden – auch ohne Angabe eines Kündigungsgrundes. Diese Freiheit wird jedoch in bestimmten Fällen eingeschränkt – insbesondere dann, wenn ein Mitarbeitender aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig ist.
Gemäss Art. 336c des Obligationenrechts (OR) sind Kündigungen während bestimmter Sperrfristen nicht zulässig, wenn die Arbeitsunfähigkeit unverschuldet – also etwa aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls – erfolgt ist. Diese Sperrfristen gelten ausschliesslich nach Ablauf der Probezeit und sind wie folgt gestaffelt:
- Während des ersten Dienstjahres: 30 Tage
- Vom zweiten bis und mit fünftem Dienstjahr: 90 Tage
- Ab dem sechsten Dienstjahr: 180 Tage
Tritt die Krankheit vor oder während einer gültigen Kündigungsfrist ein und fällt in eine dieser Sperrfristen, darf das Arbeitsverhältnis in dieser Zeit nicht rechtswirksam beendet werden. Eine während der Sperrfrist ausgesprochene Kündigung ist ungültig und muss nach Ablauf dieser Schutzperiode neu ausgesprochen werden, um Wirkung zu entfalten.

Verlängerung der Kündigungsfrist bei Krankheit nach Kündigung
Kommt es nach der Kündigung zu einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, bleibt die Kündigung in der Regel gültig. Allerdings verlängert sich die Kündigungsfrist in diesem Fall um die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, wobei die Verlängerung auf die jeweilige gesetzliche Sperrfrist begrenzt ist.
Beispiel: Eine Mitarbeiterin im vierten Dienstjahr wird am 1. Juni mit einer Frist von einem Monat gekündigt. Am 15. Juni erkrankt sie schwer und ist 40 Tage arbeitsunfähig. Die Kündigungsfrist verlängert sich um diese 40 Tage – da sie innerhalb der gesetzlich vorgesehenen 90 Tage Sperrfrist liegen.
Wichtig: Diese Regelung gilt nur, wenn die Kündigung vom Arbeitgeber ausgesprochen wurde. Bei einer Eigenkündigung durch die Mitarbeitenden bleibt der Kündigungstermin auch bei anschliessender Erkrankung unverändert bestehen.
Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz während Krankheit
Ein zentrales Thema bei krankheitsbedingter Abwesenheit ist die Frage nach der Lohnfortzahlung. Gemäss Art. 324a OR sind Arbeitgebende verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen den Lohn weiterhin auszurichten. Im ersten Dienstjahr gilt eine Mindestdauer von drei Wochen. Danach richtet sich die Lohnfortzahlungspflicht nach kantonalen Skalen – etwa der Berner, Basler oder Zürcher Skala – die je nach Dienstjahren und Region variieren.
Ist zusätzlich eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen worden, kann diese den Lohnersatz während der Arbeitsunfähigkeit weiter absichern – oft bis zu 80 % des letzten Lohns und über einen deutlich längeren Zeitraum. Diese Versicherung ist nicht obligatorisch, wird jedoch von vielen Unternehmen freiwillig abgeschlossen, um finanzielle Belastungen zu mildern – sowohl für den Betrieb als auch für die betroffene Person.

Wie Sie sich auf eine rechtssichere Kündigung vorbereiten
Eine Kündigung während oder im Anschluss an eine Krankheitsphase darf keinesfalls leichtfertig erfolgen. Arbeitgebende sollten folgende Punkte im Vorfeld besonders sorgfältig prüfen:
1. Arbeitsvertrag und interne Vereinbarungen prüfen
Kontrollieren Sie, ob im Arbeitsvertrag, in einem Gesamtarbeitsvertrag oder in internen Weisungen besondere Bestimmungen zu Kündigungen bei Krankheit geregelt sind. Diese können über das gesetzliche Minimum hinausgehen und müssen eingehalten werden.
2. Leistung und Verhalten dokumentieren
Wenn die Kündigung auf Leistungsmängel oder Fehlverhalten zurückzuführen ist, muss dies nachweislich dokumentiert sein – beispielsweise durch schriftliche Abmahnungen, Zielvereinbarungen oder Zwischenzeugnisse.
3. Persönliches Gespräch führen
Ein direktes, respektvolles Gespräch mit der betroffenen Person ist entscheidend. Machen Sie Ihre Überlegungen transparent, zeigen Sie Verständnis für die gesundheitliche Situation, und hören Sie der Gegenseite aktiv zu.
4. Verlängerte Kündigungsfristen beachten
Vergewissern Sie sich, dass Sie allfällige Sperrfristen korrekt anwenden und die Kündigung nicht in eine geschützte Zeit fällt. Im Zweifelsfall ist eine Konsultation mit juristischer Unterstützung sinnvoll.
Der Kündigungsprozess: Sorgfalt und Respekt im Vordergrund
1. Schriftliche Unterlagen vorbereiten
Das Kündigungsschreiben sollte das Beendigungsdatum und die geltende Kündigungsfrist enthalten. Eine Begründung ist rechtlich nicht zwingend erforderlich, kann aber eingefordert werden.
2. Kündigung im persönlichen Gespräch übermitteln
Übergeben Sie die Kündigung persönlich in einem diskreten Rahmen, idealerweise im Beisein einer dritten Person (z. B. HR). Dokumentieren Sie das Gespräch und bieten Sie Unterstützung an.
3. Kündigungsfrist und letzter Arbeitstag
Planen Sie frühzeitig: Arbeitszeugnis, Lohnabrechnungen, Rückgabe von Arbeitsmitteln und offene Ferien-/Überstundenregelungen. Achten Sie auf allfällige Verlängerungen wegen Krankheit.
4. Auf rechtliche Schritte vorbereitet sein
Wenn Mitarbeitende gegen die Kündigung vorgehen, ist eine gute Dokumentation zentral. Bewahren Sie alle Unterlagen und Gesprächsnotizen auf. Holen Sie bei Bedarf juristische Unterstützung.
Fazit: Kündigungen mit Augenmass und Verantwortung
Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses während einer Krankheitsphase ist eine komplexe Herausforderung, die hohe Sensibilität und fundiertes Wissen erfordert. Halten Sie sich an die gesetzlichen Sperrfristen, kommunizieren Sie transparent, und suchen Sie wenn möglich nach alternativen Wegen.
Nur so wird eine Lösung gefunden, die sowohl rechtlich korrekt als auch menschlich vertretbar ist.

Häufige Fragen (FAQ)
Bin ich zur Lohnfortzahlung verpflichtet?
Ja, gemäss Art. 324a OR besteht eine Lohnfortzahlungspflicht. Im ersten Dienstjahr mindestens drei Wochen, danach gemäss kantonalen Skalen (z. B. Berner, Zürcher oder Basler).
Was passiert, wenn Mitarbeitende nach der Kündigung krank werden?
Die Kündigung bleibt gültig. Wird die erkrankte Person während der Kündigungsfrist arbeitsunfähig, verlängert sich die Frist um die Dauer der Arbeitsunfähigkeit – maximal jedoch bis zur Dauer der Sperrfrist.
Gilt die Sperrfrist auch bei Kündigung durch die Mitarbeitenden?
Nein. Wenn Arbeitnehmende selbst kündigen, gilt keine Sperrfrist.
Können krankgeschriebene Personen gekündigt werden?
Ja, jedoch nur unter Beachtung der Sperrfristen gemäss Art. 336c OR. Kündigungen während unverschuldeter Krankheit sind ungültig.
Was tun, wenn die Kündigung angefochten wird?
Holen Sie arbeitsrechtliche Beratung, dokumentieren Sie alle Schritte und sichern Sie Gesprächsnotizen.
Hinweis: Dieser Beitrag ist Teil unseres Hubs Arbeitsrecht.