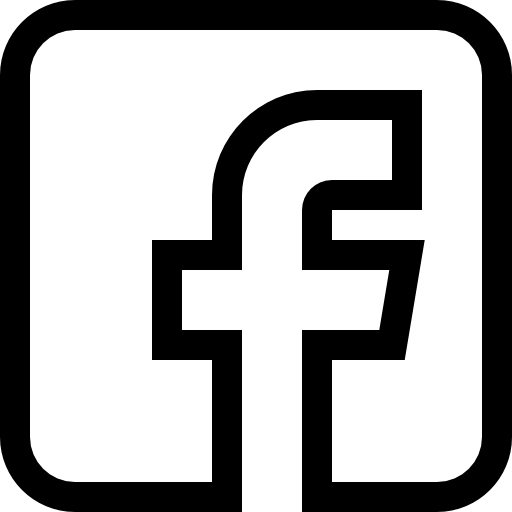Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Warum Verjährung zählt
- Rechtliche Grundlagen & Begriffe
- Zeitstrahl: Verjährung von Überstunden (Jahr 1–5)
- Verjährung vs. Verfallklausel: Der Unterschied
- Praxisbeispiele für KMU
- Nachweis & Dokumentation: So sichern Sie Ansprüche
- Checkliste für Arbeitgebende
- FAQ: Häufige Fragen
- Fazit & Handlungsempfehlung
Einleitung: Warum Verjährung zählt
Überstunden gehören in vielen Unternehmen zum Alltag. Damit es bei der Lohnabrechnung – oder spätestens beim Austritt – nicht zu Konflikten kommt, sollten Fristen zur Verjährung bekannt sein. In der Schweiz können Ansprüche auf Überstundenvergütung nicht unbegrenzt geltend gemacht werden. Dieser Beitrag erklärt die zentralen Regeln, grenzt Verjährung von Verfallklauseln ab und zeigt, wie Sie in der Praxis rechtssicher vorgehen.
Für die allgemeinen Grundlagen zu Definition und Abgrenzung empfehlen wir unseren Überblicksartikel Überstunden & Überzeit. Hier konzentrieren wir uns auf Fristen, Nachweise und typische Stolpersteine.
Rechtliche Grundlagen & Begriffe
Im Schweizer Recht ist zwischen Überstunden (Mehrarbeit über die vertragliche Arbeitszeit; geregelt in OR 321c) und Überzeit (Mehrarbeit über die gesetzliche Höchstarbeitszeit; geregelt im Arbeitsgesetz) zu unterscheiden. Für beide gilt: Ansprüche auf Vergütung oder Kompensation müssen rechtzeitig geltend gemacht und sauber dokumentiert werden.
- Überstunden (OR 321c): Abgeltung durch Freizeit oder Lohn (grundsätzlich mit 25 % Zuschlag), sofern nicht vertraglich anders geregelt.
- Überzeit (ArG): Zwingende Vergütung mit mindestens 25 % Zuschlag; jährliche Grenzen und max. 2 Stunden pro Tag. Offizielle Informationen stellt das SECO bereit.
- Verjährung: Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen (z. B. Lohnbestandteile) verjähren nach fünf Jahren (vgl. Grundsatz in OR zur fünfjährigen Frist für periodische Forderungen).
Wichtig: Verjährung bedeutet nicht, dass der Anspruch materiell „falsch“ wird; er ist nach Ablauf der Frist rechtlich nicht mehr durchsetzbar, falls die Gegenpartei die Verjährung einwendet.
Verjährung von Überstunden (Jahr 1–5)
Die Überschrift Zeitpunkt in der folgenden Tabelle zeigt, wie sich der Geltungszeitraum für Überstundenansprüche entwickelt. Er ist als Orientierungshilfe gedacht und ersetzt keine Einzelfallprüfung.
| Zeitpunkt | Anspruch & Handlung | Hinweise |
|---|---|---|
| Monat 0 (Entstehung der Überstunde) |
Überstunde entsteht durch geleistete Mehrarbeit. Erfassung im System und (wo nötig) Bestätigung durch Vorgesetzte. | Unmittelbare, lückenlose Zeiterfassung starten; Belege (Einsätze, Mails) sichern. |
| Monat 1–6 | Regelmässige Abstimmung zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten: Saldi prüfen, Kompensation planen oder Auszahlung vereinbaren. | Klare Kommunikation reduziert Streit. Protokoll/Bestätigung ablegen. |
| Monat 7–24 | Spätestens jetzt prüfen, ob Überstunden abgebaut werden können. Bei anhaltender Belastung: organisatorische Massnahmen erwägen. | Bei Kündigung frühzeitig Endabrechnung vorbereiten; Fristen im Auge behalten. |
| Jahr 3–4 | Ältere Ansprüche rücken zeitlich näher an die Verjährungsgrenze. Offene Punkte gezielt klären (Kompensation/Auszahlung). | Interne Reminder nutzen: Report zu „> 36 Monate alt“ erzeugen und Fälle bereinigen. |
| Jahr 5 | Mit Ablauf von fünf Jahren ab Fälligkeit kann sich die Gegenpartei auf Verjährung berufen. | Vor Fristablauf: Schriftlich geltend machen und Einigung dokumentieren. |

Verjährung vs. Verfallklausel: Der Unterschied
In Arbeitsverträgen oder Reglementen finden sich manchmal Verfallklauseln (z. B. „Ansprüche müssen innert 3 Monaten geltend gemacht werden, sonst verfallen sie“). Diese Klauseln sind von der gesetzlichen Verjährung zu unterscheiden:
- Verjährung ist gesetzlich geregelt (grundsätzlich fünf Jahre bei periodischen Leistungen). Sie kann nicht einseitig „verkürzt“ werden.
- Verfallklauseln setzen vertragliche Fristen zur Geltendmachung. Ihre Zulässigkeit und Reichweite hängen von Formulierung, Transparenz und Einzelfall ab. Zu strenge oder unklare Klauseln können unwirksam sein.
Praxis-Tipp: Prüfen Sie arbeitsvertragliche Klauseln sorgfältig und verwenden Sie klare, verhältnismässige Fristen.
Praxisbeispiele für KMU
Beispiel 1: Regelmässige Mehrarbeit im Büro
Eine Sachbearbeiterin arbeitet über Monate hinweg 1–2 Stunden pro Woche zusätzlich. Das Unternehmen nutzt digitale Erfassung und genehmigt monatliche Saldi. Quartalsweise werden 50 % kompensiert, der Rest ausbezahlt. Ergebnis: Keine Altsalden, keine Verjährungsrisiken.
Beispiel 2: Projektspitze in der IT
Ein Entwicklerteam leistet während eines Rollouts 60 Überstunden. Die Kompensation ist aus Projektgründen erst nach Go-live möglich. Das HR plant mit der Linie im Voraus zwei Kompensationsblöcke und hält die Vereinbarung schriftlich fest. Die ältesten Stunden werden priorisiert abgebaut.
Beispiel 3: Austritt ohne Abbau
Eine Mitarbeiterin kündigt; 40 Überstunden sind offen. Eine Kompensation ist in der kurzen Frist nicht realistisch. Das Unternehmen rechnet die Stunden in der Endabrechnung aus, trennt sauber zwischen Überstunden und Überzeit und weist Zuschläge korrekt aus.
Nachweis & Dokumentation: So sichern Sie Ansprüche
Ohne Nachweis ist jede Fristdiskussion müssig. Deshalb gilt:
- Zeiterfassungspflicht ernst nehmen: Arbeitszeiten zeitnah und vollständig erfassen (Kommen/Gehen, Pausen, Einsatzort).
- Genehmigungsprozesse definieren: Wer prüft, wer genehmigt, in welcher Frequenz? Idealerweise monatlich oder quartalsweise.
- Kategorien trennen: Überstunden vs. Überzeit getrennt führen – inkl. Zuschlägen und Jahreskontingenten.
- Archivierung: Reports, E-Mails, Anordnungen und Vereinbarungen revisionssicher ablegen.
Mit der TimeSafe Zeiterfassung lassen sich Regeln hinterlegen (z. B. Höchstarbeitszeit, Zuschläge), sodass Berichte automatisch revisionsfest zwischen Überstunden und Überzeit unterscheiden.

Checkliste für Arbeitgebende
- Vertrag prüfen: Was steht zu Überstunden, Kompensation, Zuschlägen und allfälligen Verfallklauseln?
- Rollen & Prozesse: Zuständigkeiten für Prüfung/Genehmigung definieren; Frequenz festlegen (monatlich/Quartal).
- Transparente Kommunikation: Saldi regelmässig mit Mitarbeitenden besprechen (z. B. im Mitarbeitergespräch).
- Priorisierung älterer Stunden: Altsalden abbauen, bevor sie zeitlich an die Verjährungsgrenze kommen.
- Digitale Dokumentation: Systematische, nachvollziehbare Erfassung (Berichte, Sign-Offs, Vereinbarungen).
- Endabrechnung bei Austritt: Offene Stunden klar ausweisen und korrekt vergüten.
FAQ: Häufige Fragen
Wie lange kann man Überstunden in der Schweiz rückwirkend geltend machen?
Grundsätzlich gilt eine fünfjährige Verjährungsfrist für periodische Lohnansprüche. Entscheidend ist eine saubere Dokumentation und rechtzeitige Geltendmachung.
Was ist der Unterschied zwischen Verjährung und Verfall?
Verjährung ist gesetzlich vorgegeben und setzt die Durchsetzbarkeit nach Fristablauf ausser Kraft (bei Einrede). Verfallklauseln sind vertragliche Meldefristen, deren Zulässigkeit vom Einzelfall abhängt.
Helfen Erinnerungen im System gegen Verjährung?
Ja. Regelmässige Reports (z. B. „Überstunden > 36 Monate“) ermöglichen gezielte Bereinigung vor Fristablauf.
Gilt die fünfjährige Frist auch für Überzeit?
Überzeit ist inhaltlich anders geregelt (zwingende Zuschläge), doch auch hier handelt es sich um Lohnbestandteile. In der Praxis sollte die Geltendmachung ebenfalls zeitnah erfolgen.
Können Überstunden „mit dem Lohn abgegolten“ sein?
Teilweise ja, falls klar und zulässig vertraglich vereinbart. Das ändert jedoch nichts an der Notwendigkeit der Erfassung und an Fristen für allfällige Restansprüche.
Was, wenn die Gegenpartei die Verjährung nicht einwendet?
Dann kann trotz abgelaufener Frist eine freiwillige Zahlung erfolgen. Rechtlich durchsetzbar ist der Anspruch ohne Einrede aber nicht.
Fazit & Handlungsempfehlung
Wer Verjährungsfristen kennt und konsequent dokumentiert, vermeidet Streit und Kosten. Entscheidend sind klare Prozesse, Transparenz und eine saubere Trennung von Überstunden und Überzeit. Mit der TimeSafe Zeiterfassung lassen sich Saldi, Genehmigungen und Abrechnungen strukturiert abbilden – inklusive Regeln zu Höchstarbeitszeit, Zuschlägen und Berichten. Für die Einordnung der Grundlagen empfehlen wir ergänzend den Überblicksartikel Überstunden & Überzeit.
Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar. Stand: 26. September 2025.