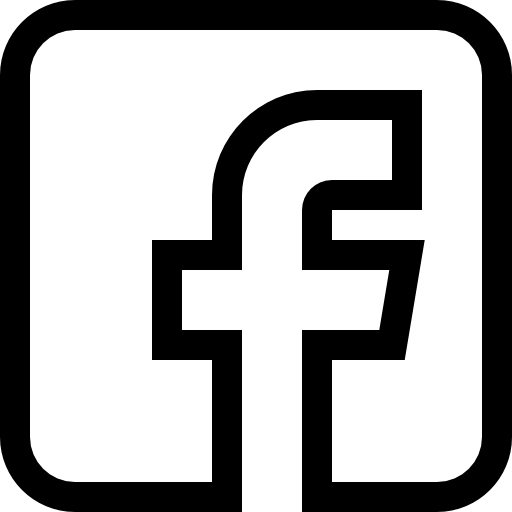Inhaltsverzeichnis
- Kontext: Wo steht die Schweiz aktuell?
- Die Kernelemente der Vorlage in Kürze
- Auswirkungen auf Zeiterfassung & Arbeitsorganisation
- Welche Policies sollten Unternehmen jetzt prüfen?
- Praxisbeispiele: So könnte es im Alltag aussehen
- Checkliste: 12 Sofortmassnahmen für Compliance & Alltag
- FAQs
- Fazit & nächste Schritte
Kontext: Wo steht die Schweiz aktuell?
Die Flexibilisierung der Telearbeit (Homeoffice/Mobiles Arbeiten) nimmt Gestalt an: Am 21. Mai 2025 hat der Bundesrat die Stossrichtung der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) mehrheitlich begrüsst. Zugleich befürwortet er die gesetzliche Verankerung eines Rechts auf Nichterreichbarkeit während Ruhezeiten und am Sonntag. Damit sollen Schutz und Flexibilität in einer digitalisierten Arbeitswelt besser austariert werden (Medienmitteilung des Bundes).
Die Vorlage stützt auf die parlamentarische Initiative 16.484 «Mehr Gestaltungsfreiheit bei Arbeit im Homeoffice». Dossier, Texte und Verfahrensstand sind in Curia Vista sowie im Bundesblatt (BBl 2025 1793) dokumentiert. Stand 25. September 2025: Der parlamentarische Prozess ist noch nicht abgeschlossen; Unternehmen sollten jedoch bereits heute ihre Reglemente, Systeme und Gewohnheiten kompatibel ausrichten.
Wichtig bleibt: Die allgemeinen Schutzvorschriften des Arbeitsgesetzes (ArG) zu Arbeits- und Ruhezeiten gelten weiter. Eine kompakte Übersicht bietet das SECO. Was sich ändert, ist primär der Gestaltungsspielraum – und damit die Notwendigkeit, Regeln technisch und organisatorisch sauber abzubilden, z. B. in der TimeSafe Zeiterfassung.
Die Kernelemente der Vorlage in Kürze
- Längere tägliche Arbeitszeitspanne: Tages-/Abendarbeit könnte innerhalb von 17 Stunden geleistet werden (heute 14), primär für Funktionen mit namhafter zeitlicher Autonomie (WAK-N, 10.09.2024).
- Mindestruhezeit: Im Entwurf Reduktion von 11 auf 9 Stunden, flankiert durch Schutzmechanismen und Auflagen (WAK-N).
- Recht auf Nichterreichbarkeit: Gesetzliche Verankerung, insbesondere während täglicher Ruhezeiten und am Sonntag (Bund).
- Geltungsbereich fokussieren: Flexibilisierung vor allem für Mitarbeitende, die ihre Arbeitszeit zu einem namhaften Teil selbst festlegen können (Curia Vista).
Unverändert bleiben die Grundlogiken zu Tages-/Abendarbeit, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit, Pausen und Ruhezeiten. Wer die zusätzliche Flexibilität nutzen will, sollte die Schutzvorschriften als Systemlogik definieren (Regeln, Prüfungen, Eskalationspfade) – nicht bloss als PDF-Reglement.
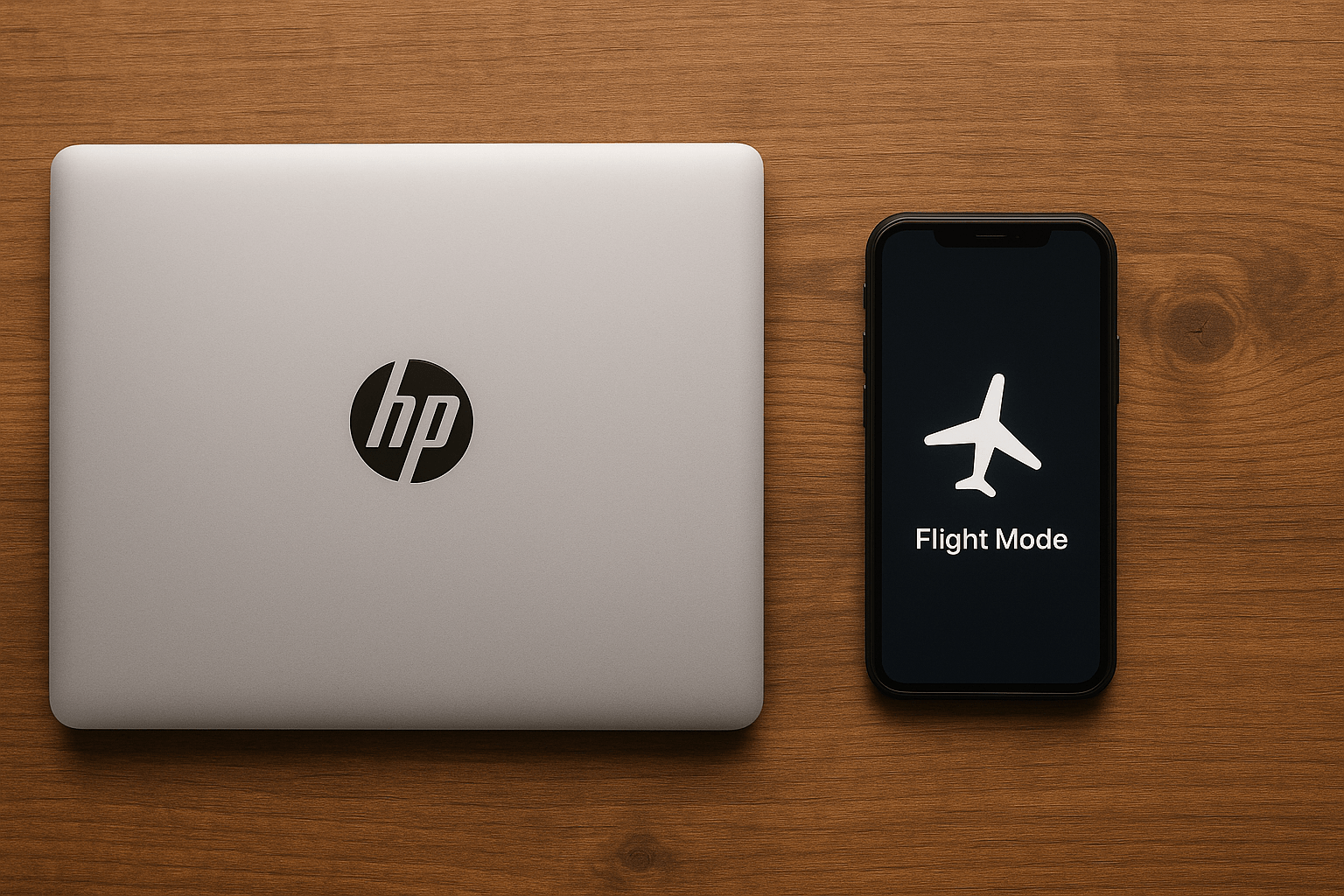
Auswirkungen auf Zeiterfassung & Arbeitsorganisation
1) Zeiterfassung wird wichtiger – nicht obsolet
Mehr Freiheit heisst mehr Verantwortung: Arbeits- und Ruhezeiten müssen korrekt dokumentiert werden – auch für autonome Rollen. Der Nachweis bleibt rechtlich relevant (z. B. bei Ruhezeit, Sonntagsarbeit, Überzeit). Das SECO beschreibt weiterhin die Wahl zwischen Vollerfassung, vereinfachter Erfassung oder – unter klaren Voraussetzungen – Verzicht gemäss ArGV 1 Art. 73a/73b (SECO: Arbeitszeiterfassung).
In der Praxis lässt sich das in der TimeSafe Zeiterfassung abbilden: Regeln hinterlegen, Buchungen plausibilisieren, Ausnahmen sauber protokollieren, revisionsfeste Reports erzeugen. Grundlagen und Kontext im Beitrag Arbeitszeiterfassung: Gesetze & Pflichten.
2) Technische „Schutzschranken“ im Alltag
- Automatische Ruhezeit-Checks: Buchungen, die Ruhezeiten unterschreiten, werden markiert oder benötigen eine Freigabe; die Begründung wird protokolliert (Vorlage gemäss WAK-N).
- Nichterreichbarkeit unterstützen: „Quiet Hours“ in Kollaborationstools sowie die Sperrung von Zeiterfassungsbuchungen während Schutzfenstern. Im TimeSafe Web-Client lässt sich dies als Regel hinterlegen.
- Sonntags-Opt-in & Limits: Falls freiwillige Kurz-Einsätze vorgesehen sind, sind klare Kontingente und Prozedere nötig. Fachlicher Anknüpfungspunkt: Überstunden & Überzeit.
3) Arbeitszeitmodelle mit 17-Stunden-Korridor denken
Gleitzeit, Jahresarbeitszeit und Vertrauensarbeitszeit gewinnen an Spielraum – aber nur, wenn die Balance zwischen Flexibilität und Erholung gewahrt bleibt. Orientierung zu Gleitzeit und Pflichten bietet der Beitrag Gleitzeit: Rechte & Pflichten. Operativ werden Kernzeiten/Erreichbarkeitsfenster, Ruhezeiten und Kontingente im System parametrisiert; ein transparenter Soll-/Ist-Abgleich vermeidet Excel-Schlaufen.
4) Gesundheitsschutz bleibt zentral
Längere Korridore dürfen nicht zu längeren Arbeitstagen werden. Neben Pausenpflege und Ergonomie lohnt ein Blick auf Evidenz: Laut WHO/ILO ist Arbeiten mit 55+ Stunden/Woche mit +35 % Schlaganfall-Risiko und +17 % Mortalitätsrisiko für ischämische Herzkrankheit assoziiert (vs. 35–40 Std./Woche). Die Studienlage mahnt zu strukturierten Grenzen – unabhängig vom Arbeitsort (WHO/ILO).
Praktisch heisst das: Limits für Spätarbeit, Monitoring von sehr langen Tagen, Reminder für Pausen und eine unkomplizierte Möglichkeit, Ausgleich zu planen. Reporting und Dashboards in TimeSafe können als „sanfte Steuerung“ dienen (Hinweise statt Überwachung).

Welche Policies sollten Unternehmen jetzt prüfen?
1) Arbeitszeit- & Homeoffice-Reglement
- Geltungsbereich definieren: Welche Funktionen verfügen über „namhafte“ Autonomie? Dokumentieren und regelmässig prüfen (vgl. Curia Vista 16.484).
- Arbeitszeitfenster & Kernzeiten festlegen: Team-Kernzeiten, Erreichbarkeitsfenster und 17-Stunden-Korridor so festlegen, dass Zusammenarbeit funktioniert (WAK-N).
- Ruhezeitregel: Heute 11 Stunden, im Entwurf 9 Stunden – inklusive Ausnahmen mit Freigabeprozess (SECO).
- Sonntag: Falls freiwillige Kurz-Einsätze erlaubt, dann mit Opt-in, Limits und Protokollierung (Konfiguration über Systemregeln; Auswertung in Berichten).
Tipp: Regeln nicht nur „aufschreiben“, sondern im System verankern. Wer zusätzlich Leistungen/Projekte nachweisen will, kann dies mittels der TimeSafe Option Auftragszeit im Prozess bündeln.
2) Recht auf Nichterreichbarkeit
- Schutzzeiten definieren: Keine Anrufe/Chats/E-Mails während Ruhezeiten & am Sonntag; Ausnahmen dokumentieren.
- Technik-Support: „Quiet Hours“, „Delayed Send“ und Sperrlogiken in der Zeiterfassung.
- Vorbild Führung: Keine spätabendlichen Mails; klare Eskalationswege nur für echte Notfälle.
Pragmatisch umgesetzt, erhöht Nichterreichbarkeit die Konzentration im Arbeitsfenster – und senkt Konflikte über „ständige Verfügbarkeit“.
3) Zeiterfassung & Compliance
- Erfassungsart wählen: Vollerfassung, vereinfachte Erfassung oder – wo zulässig – Verzicht gemäss ArGV 1/Art. 73a/73b (siehe SECO).
- Alerts & Reports: Ruhezeitverletzungen, Sonntagsarbeit, lange Tage & Wochenlast automatisiert überwachen; Ausnahmen nachvollziehbar protokollieren.
- Datenschutz: Nur notwendige Daten erfassen; Verhaltensüberwachung vermeiden. Leitplanken erläutert der EDÖB.
4) Arbeitssicherheit & Ergonomie
- Ergonomiestandard: Mindestanforderungen für Homeoffice-Arbeitsplätze (Bildschirm, Stuhl, Licht), Self-Audit-Checkliste und Onboarding-Hinweise.
- Pausen & Mikro-Erholung: Regelmässige kurze Pausen mit Erinnerungsfunktion; Richtwert-Tipps im Reglement und in der Mitarbeiter-App.
- Monitoring ohne Druck: Dashboards, die Belastungen sichtbar machen (lange Tage, späte Blöcke), aber keine Performance-Überwachung abbilden.
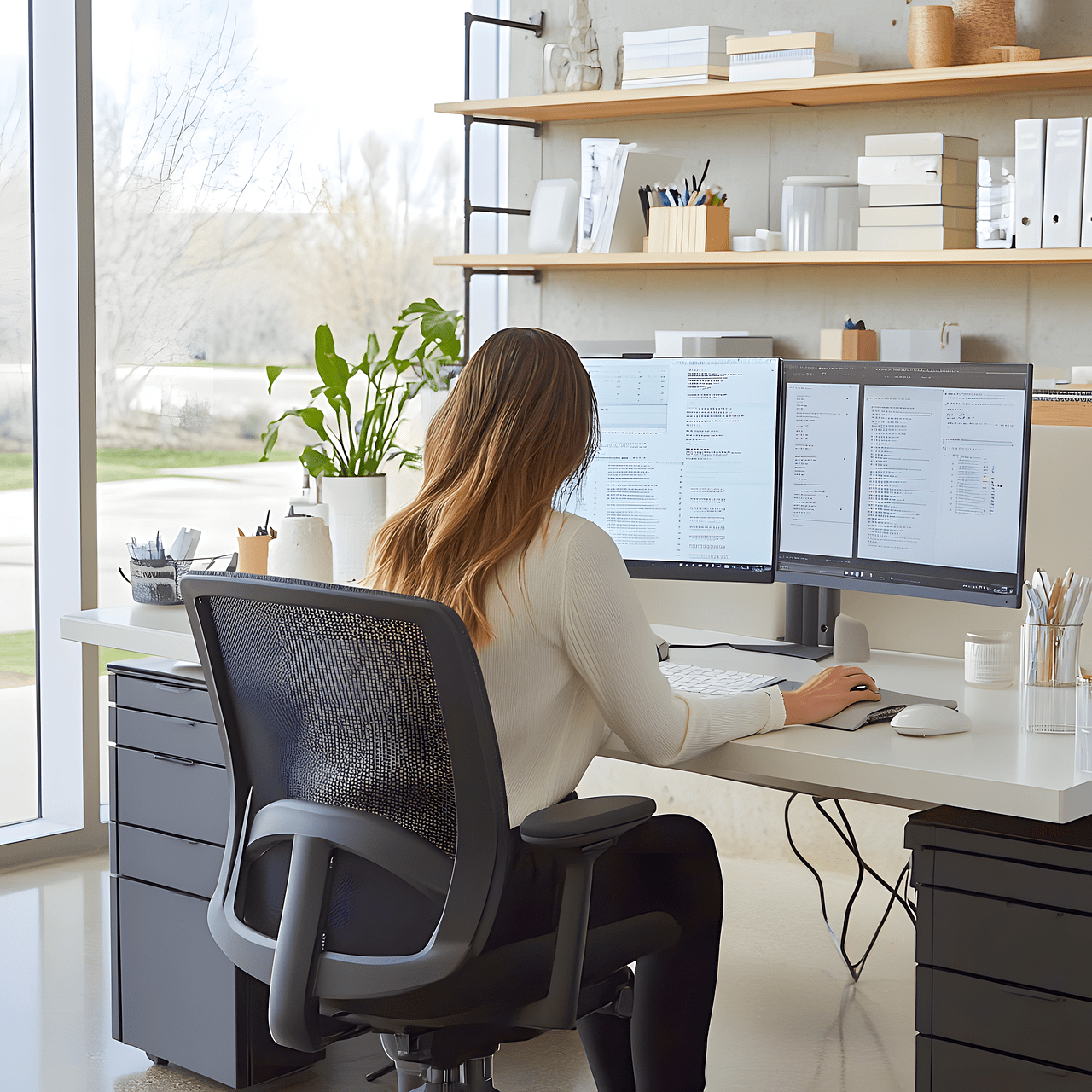
Praxisbeispiel: So könnte es zukünftig im Alltag aussehen
Beispiel A: Mitarbeiterin mit hoher Autonomie
Situation: Hybrides Arbeiten, Kernzeit 09:30–15:00. Kundencall bis 21:45.
- Systemschutz: Nächste Buchung erst nach 9-Stunden-Ruhezeit (Entwurfslogik, vgl. WAK-N) – in TimeSafe konfiguriert; TimeSafe protokolliert eine allfällige Verletzung und zeigt diese sofort an.
- Nichterreichbarkeit: „Delayed Send“ für Mails; Kollaborationstool in „Quiet Hours“. Die IT verhindert die interne Mail-Zustellung während definierten Schutzfenstern.
- Gesundheitsschutz: Hinweis, wenn mehrere Spät-Tage in Folge auftreten; Vorschlag für Ausgleichstag: Mittels eigener Regel lässt sich dies spielt leicht in TimeSafe abbilden.
Beispiel B: Mitarbeiter mit definierten Fenstern
Situation: 3-Schichten-Modell, Homeoffice möglich. Freiwillige Sonntagsarbeit max. 5 h/Monat pro Person.
- Opt-in: Sonntagsbuchungen sind nur im Self-Service-Portal möglich.
- Transparenz: Dashboard zeigt Sonntags-Saldo pro Kopf/Monat.
Checkliste: 12 Sofortmassnahmen für Compliance & Alltag
- Scope festlegen: Funktionen mit „namhafter Autonomie“ definieren und dokumentieren (Referenz: Curia Vista).
- Kernzeiten & Erreichbarkeit: Team-Kernzeiten, 17-Stunden-Arbeitsfenster und Eskalationskanäle festlegen.
- Ruhezeitregel konfigurieren: Heute 11 Std.; Entwurfslogik 9 Std. als Systemregel hinterlegen (inkl. Freigabeprozess) – siehe SECO.
- Nichterreichbarkeit: „Quiet Hours“ und „Delayed Send“ verpflichtend machen.
- Sonntags-Opt-in: Freiwilligkeit in Reglements-Entwurf und System abbilden; Auswertungen im Monatsreport.
- Erfassungsart definieren: Vollerfassung, vereinfachte Erfassung oder Verzicht (ArGV 1 Art. 73a/73b) – SECO-Leitplanken.
- Dashboards & Alerts: Lange Tage, Ruhezeitverstösse, Sonntagsarbeit automatisch überwachen; Ausnahmen dokumentieren.
- Datenschutz-Leitplanken: Zweckbindung & Minimierung; keine verdeckte Leistungsüberwachung (vgl. EDÖB).
- Ergonomie-Standard: Mindestanforderungen (Stuhl, Bildschirm, Licht) definieren; Self-Audit für Homeoffice.
- Pausenpflege: Kurzpausen guidelines und Erinnerungen; Fokus auf Regeneration statt „Marathon-Pausen“.
- Führungskräftetraining: Vorbildfunktion bei Nichterreichbarkeit und E-Mail-Kultur; Eskalation nur für Notfälle.
- Kommunikation & Schulung: Regeln in Onboarding & Team-Briefings integrieren; FAQ für Mitarbeitende bereitstellen.
FAQs
1) Ist die Vorlage schon Gesetz?
Noch nicht. Der Bundesrat hat am 21. Mai 2025 die Stossrichtung begrüsst; die parlamentarische Beratung läuft weiter.
2) Gilt das Recht auf Nichterreichbarkeit für alle?
Der Ansatz ist allgemein gedacht: Nichterreichbarkeit mindestens während Ruhezeiten und am Sonntag; Details ergeben sich aus der finalen Gesetzesfassung.
3) Wird die tägliche Arbeitszeitspanne auf 17 Stunden erweitert?
Das ist Teil der Entwurfslogik der WAK-N; die endgültige Ausgestaltung liegt beim Parlament.
4) Was ändert sich für die Zeiterfassung?
Mehr Flexibilität bedeutet mehr Bedarf an sauberer Dokumentation, automatisierten Ruhezeit-Checks und klaren Prozessen. In TimeSafe lassen sich Regeln, Freigaben und Reports abbilden.
5) Wie ist Sonntagsarbeit im Homeoffice zu verstehen?
Diskutiert werden begrenzte, freiwillige Kurz-Einsätze mit Limits/Opt-in; Konkretes hängt vom Gesetzeswortlaut ab.
6) Müssen Arbeitsverträge angepasst werden?
Meist genügen Reglemente/Anhänge: Geltungsbereich, Zeitfenster, Ruhezeit, Nichterreichbarkeit, Sonntags-Opt-in sowie Daten-/IT-Regeln. Die Umsetzung erfolgt pragmatisch über Systemregeln.
7) Wie schützen wir die Gesundheit bei längeren Korridoren?
Mit Pausenpflicht, Limitierung von Spätarbeit, Monitoring und Empfehlungen. Evidenz zu Risiken langer Arbeitszeiten liefert die WHO/ILO-Analyse.
8) Wie bleibt der Datenschutz gewahrt?
Datensparsamkeit, Transparenz, klare Zwecke. Keine Verhaltensüberwachung; Orientierung beim EDÖB. Zeiterfassung dient der Compliance – nicht der Leistungskontrolle.
Fazit & nächste Schritte
Die Schweiz steuert auf mehr Gestaltungsfreiheit zu – flankiert von klaren Schutzschranken. Wer Reglemente, Prozesse und Systeme heute ausrichtet, ist morgen schneller compliant, unabhängig von Detailänderungen im Parlament. Die offiziellen Unterlagen liefern den Rahmen (BBl 2025; Bund).
Für die Umsetzung im Alltag zählen klare Regeln, einfach bedienbare Tools und transparente Nachweise. Mit sauber konfigurierten Schutzzeiten, Kernzeiten, Kontingenten und Reporting lässt sich Flexibilität leben – ohne die Gesundheit und Rechtssicherheit zu gefährden. Vieles davon lässt sich direkt in der Zeiterfassung und ergänzenden Leistungserfassung abbilden.
Hinweis: Dieser Beitrag ist Teil unseres Hubs Arbeitszeitmodelle & Regelungen.
Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar. Stand: 25. September 2025.